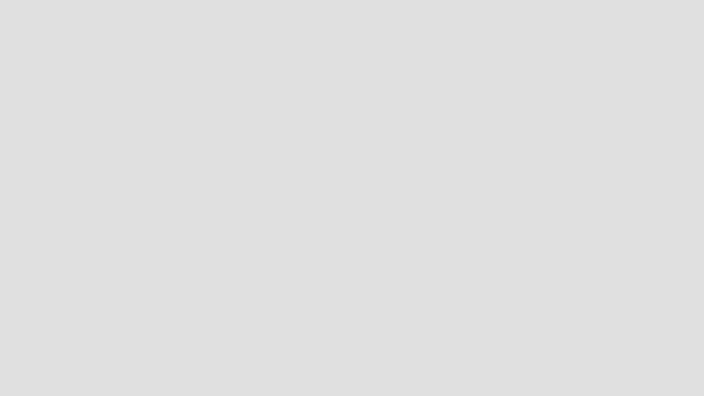Barack Obama hatte in den vergangenen Jahren zwei wichtige Ämter inne. Zum einen war er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Zum anderen war er Coach der Basketball-Mannschaft seiner Tochter Sasha. In dieser Eigenschaft dürfte er seinen Spielerinnen immer wieder mal in einer Halbzeitpause gepredigt haben, sie müssten etwas mehr Angriffslust zeigen, sonst werde das nichts mit dem Sieg.
Dem Coach Obama wird daher wohl gefallen, wie der Präsident Obama die zweite Hälfte seiner Amtszeit angeht. Das offizielle Tamtam an diesem Montag - Vereidigung, Rede, Parade, Bälle - hat Obama gar nicht erst abgewartet. Schon kurz nach seiner Wiederwahl im November hat er den Ton gegenüber den Republikanern verschärft. Obama weiß, dass er nicht viel Zeit hat, bis er zur "lame duck" wird, zum flügellahmen Demnächst-Ex-Präsidenten.
Er sieht, dass die Republikaner den Schock der Niederlage noch nicht verwunden haben, noch taumeln sie ziel- und führungslos umher. Und er ist Kämpfer genug, um jetzt mit einer gewissen Genugtuung und Rücksichtslosigkeit über jene engstirnigen, biestigen republikanischen Hinterwäldler hinwegzuwalzen, die ihn in den vergangenen vier Jahren so getriezt haben.
Und so walzt er. In den wenigen Wochen seit November hat Obama den Republikanern eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und der Schuldenobergrenze abgepresst; er hat ihnen in Chuck Hagel einen Dissidenten aus den eigenen Reihen als neuen Verteidigungsminister vorgesetzt; und er hat ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf den Tisch geknallt, um die Waffengesetze zu verschärfen - alles ebenso richtig wie bisher undenkbar.
Obama muss Romneys Fehler vermeiden
Als Obama vor vier Jahren Präsident wurde, war er beseelt von dem Wunsch nach "Überparteilichkeit", nach vernünftigen Kompromissen zum Wohle der Nation. Vier Jahre lang haben ihn die Republikaner auflaufen lassen. (Auch wenn Obama selbst gelegentlich so dilettierte, dass seine Gegner es deswegen erheblich leichter hatten.) Jetzt, so könnte man sagen, hat der Präsident die Schnauze voll.
Das ist verständlich. Ohne Gewalt, zwar nicht körperliche, aber dennoch politische, sind in Washington derzeit auch kaum Erfolge zu erzielen. Aber Obama muss aufpassen, dass die Brechstange nicht zu seinem einzigen Werkzeug wird - und er so vom Versöhner, als der er einst antrat, nicht zum Spalter mutiert.
Obamas Argument, er habe schließlich die Wahl gewonnen, trägt nicht allzu weit. Das kann jeder republikanische Parlamentarier auch von sich behaupten. Und nicht alle Einwände, die Obamas politische Gegner vorbringen, entspringen stumpfer Ideologie.
Nicht jeder Abgeordnete, der sich wegen der horrenden Staatsverschuldung Sorgen macht und weitere Kredite an Ausgabenkürzungen koppeln möchte, ist deswegen - wie Obama insinuierte - ein Erpresser, der dem Land "die Pistole an den Kopf hält" und "Lösegeld" fordert. Und nicht jeder Senator, der Obamas Pläne für schärfere Waffengesetze ablehnt, ist eine Marionette der Waffenlobby.
Vor allem aber darf Obama eines nicht übersehen: Jeder dieser lästigen Republikaner im Kongress vertritt eine ganze Menge einfache Bürger. Macht Obama so weiter wie in den vergangenen Wochen, dann läuft er Gefahr, irgendwann in seine eigene "47-Prozent-Falle" zu tappen. Mitt Romney tat während des Wahlkampfs knapp die Hälfte der Wähler als Sozialschmarotzer ab, die ohnehin nur die Demokraten wählten - eine dumme und beleidigende Bemerkung.
Obama darf nun nicht den gleichen Fehler machen und die anderen 47 Prozent der Amerikaner als unbelehrbar oder unwichtig abschreiben, nur weil sie im November für die andere Mannschaft waren. Politik ist nicht Basketball.