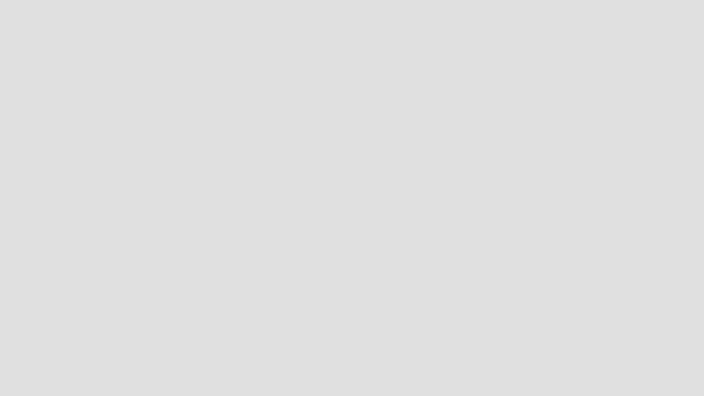Wenn man ihn auf seine Heimat anspricht, kann Fabrizio Capobianco schon einmal ärgerlich werden. "Die Politiker sollen aus dem Weg gehen", schimpft der italienische Gründer des Cloud-Dienstes Funambol. "Wir brechen hier im Silicon Valley Regeln. In Europa würde es schon reichen, wenn Politiker den Start-ups das Leben wenigstens nicht erschweren."
Capobianco gründete 1995 eine der ersten Internetfirmen seines Heimatlandes, doch um erfolgreich zu sein, musste er den alten Kontinent verlassen und ins Tal der Hochtechnologie gehen. An diesem Nachmittag trifft er im Computer History Museum von Mountain View quasi seine Nachfolger: Gründer und Firmen-Manager aus ganz Europa sind für eine Woche angereist, um unter dem Motto "Startup Europe Comes To Silicon Valley" Firmen wie Apple oder die Investoren von Andreessen Horowitz zu besuchen und EU-Digitalkommissar Günther Oettinger zu treffen, der ebenfalls in der Region weilt.
Investitionen in europäische Startups steigen
Die gute Nachricht lautet: Anders als einst Capobianco können sie guten Gewissens wieder nach Hause zurückkehren. Die Investitionen in europäische Technologie-Firmen steigen stetig, Start-ups werden in diesem Jahr Prognosen zufolge erstmals mehr als zehn Milliarden US-Dollar Risikokapital einsammeln. Alleine deutsche Jungfirmen - die meisten davon aus Berlin - sicherten sich im ersten Halbjahr 2015 etwa 1,9 Milliarden Euro, 300 Millionen mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Die Niedrigzinspolitik lässt Wagniskapitalfonds aus dem Boden schießen, ein Trend, der sich durch die 2016 erwarteten Effekte der EZB-Anleihenkäufe noch verstärken dürfte.
Und auch kulturelle Unterschiede lösen sich auf - zumindest ein wenig. "Die Europäer waren lange risikoscheu, das hat sich geändert", sagt Charles Versaggi, Leiter eines Start-up-Programms in der Gegend, "dauernd kommen hier Jungfirmen aus Deutschland, England oder Frankreich her, um etwas zu lernen. Silicon Valley ist kein Ort mehr, sondern eine Haltung."
Die Honigtöpfe stehen in den USA
Jede Woche sind etwa 300 EU-Start-ups im Silicon Valley, schätzt Sean Randolph vom Bay Area Council Economic Institute - viele davon auf der Suche nach Investoren. Denn die Wahrheit ist auch: Die Voraussetzungen in Europa mögen sich verbessert haben, für das Hyperwachstum amerikanischer Firmen reicht es den meisten noch nicht. In diesem Jahr werden voraussichtlich erstmals mehr als 50 Milliarden Wagniskapital-Dollar in amerikanische Start-ups fließen. "Die Europäer sind noch weit hinten dran, ein vergleichbares Ökosystem aufzubauen", sagt der amerikanische Investor Ravi Lingarkar nüchtern.
"Es tut sich was, aber alles ist viel kleiner und schwieriger", bestätigt eine Gruppe Finnen. "Wer an die Honigtöpfe möchte, zieht besser in die USA", erzählt eine europäische Gründerin. "Für acht Millionen Dollar werden in Deutschland Start-ups verkauft, hier investiert man solche Beträge in frühen Wachstumsphasen", sagt Peter Braun vom Investorenverband "European Trade Association For Business Angels".
Firmen wie der französische Mitfahrdienst Blablacar, der schwedische Musik-Streamingdienst Spotify oder die britische Finanzplattform Transferwise konnten nur mithilfe amerikanischer Investoren in den Klub der Einhörner aufsteigen, jenen Start-ups, die auf dem Papier mehr als eine Milliarde Dollar wert sind. Zugleich schlägt bei jeder dritten Übernahme eines europäischen Start-ups eine US-Firma zu - die relativ niedrigen Bewertungen sind ebenso attraktiv wie der einfache Zugang zum komplexen europäischen Absatzmarkt. Europas Unternehmen dagegen halten sich mit Zukäufen häufig vornehm zurück, weil sie ihre neuen Geschäftszweige lieber intern oder in eigenen Inkubatoren entwickeln.
Europäische Vernetzung auf amerikanischem Boden
Nun muss nicht alles dem US-Modell folgen. Wie viele der hochgezüchteten Einhörner der Tech-Branche überlebensfähig sind, ist auch im Silicon Valley inzwischen umstritten. Andererseits hat sich über die Jahrzehnte eine Art Megadorf entwickelt, dessen Substanz fast jede Krise überleben kann: Tausende von Gründern, talentierten Entwicklern und Investoren sind über ein weitläufiges Netzwerk verbunden, lernen voneinander und nutzen das Geld aus ihren Firmenverkäufen, um wieder in das Ökosystem zu investieren. Mit den USA steht ihnen zudem ein Einstiegsmarkt mit theoretisch mehr als 300 Millionen Kunden zur Verfügung.
Das Gegenteil ist an diesem Nachmittag im Vorraum des Computer History Museums zu erleben: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch oder Schwedisch sind zu hören, die Reise gibt den Start-ups eine Gelegenheit zur paneuropäischen Vernetzung, die sich auf dem kleinteiligen europäischen Kontinent nur selten bietet. Und auch die Blaupause für Europas digitalen Binnenmarkt, der den Kontinent für Start-ups schneller erschließbar machen soll, dürfte noch einige Zeit zwischen den EU-Institutionen hin- und hergehen, bis sie Realität wird.
Nicht nur Exilant Fabrizio Capobianco hält die europäische Digitalpolitik für unzureichend, obwohl 40 Prozent der Anschubfinanzierungen direkt oder indirekt von Regierungen kommen. Lobbygruppen und Konzerne hätten Zugang zur Politik und könnten so ihre Interessen durchsetzen, klagt Andrew Scott von der Investmentfirma 7percent: "Der Standpunkt von Start-ups wird häufig nicht berücksichtigt."
Verbesserungsbedarf bei der europäischen Digitalpolitik
Erst kürzlich überlegte das Bundesfinanzministerium, Veräußerungsgewinne privater Start-up-Investoren ("Business Angels") zu besteuern, selbst wenn diese reinvestiert werden - jene Praxis also, die im Silicon Valley zu einem funktionierenden Ökosystem beiträgt. Am Ende landete der Entwurf erst nach lautem Protest der Gründerszene in der Schublade.
Auch die Politik des EU-Digitalkommissars Günther Oettinger wirkt defensiv und vor allem darauf bedacht, die US-Konzerne auszubremsen, statt die europäische Digitalökonomie voranzutreiben. "Uns geht es nicht darum, gegen die USA zu kämpfen, sondern darum, wettbewerbsfähig zu werden", sagte Oettinger vor Kurzem. Bisher habe der Kontinent in der digitalen Wirtschaft gegen Amerika verloren, nun drohe das auch der übrigen Wirtschaft.
Ideen für eine bessere Digital-Politik gibt es indes bereits viele: Programmieren als Pflichtfach an der Schule, wie es Großbritannien bereits eingeführt hat. Weniger Bürokratie bei der Prüfung von Investment-Verträgen und Gründungen. Größere Anstrengungen zum Breitbandausbau. Programme, um nationale Risiko-Investoren auf ein internationales Level zu bringen. Neue Schwerpunkte im BWL-Studium, um die Mechanismen der Digitalökonomie zu verstehen. Und die Anwerbung von Gründern aus anderen Ländern.
Eine lange Liste mit vielen bislang unerfüllten Wünschen. Es dürften noch Jahre vergehen, bis europäische Besuche im Silicon Valley keine Bildungs- und Geldsammel-Reisen mehr sind, sondern Treffen auf Augenhöhe.